
In ihrem Buch „Meine Eltern werden alt“ liefert die Journalistin Peggy Elfmann „50 Ideen für ein gutes Miteinander“ sowie jede Menge wertvolle Anregungen, die sich am Alltag mit alternden Eltern orientieren. Dabei weiß die Autorin nur zu gut, was es heißt, wenn sich Veränderungen schrittweise, manchmal aber auch ganz plötzlich bemerkbar machen: Als ihre Mutter mit 55 Jahren die Diagnose Alzheimer erhielt, übernahmen sie und ihr Bruder immer mehr Verantwortung und letztlich auch Entscheidungen. Ein Gespräch über das Pflegen der eigenen Eltern, Gewissenskonflikte, kostbare Momente und das allmähliche Abschiednehmen.
Veränderungen im Alltag alternder Eltern treten oftmals schleichend auf – da fällt in Familien hinsichtlich Unterstützung, Vorsorgemaßnahmen oder Pflege schon mal der Satz: „Das hat noch Zeit.“
Peggy Elfmann: Ich denke, da schwingt immer ein wenig die Angst mit, dass Entscheidungen vorschnell getroffen werden, etwa die Suche nach einem Platz im Pflegeheim – um diese Sorge mal etwas plakativ zu benennen. Da herrschen mitunter auf beiden Seiten gewisse Vorbehalte, sich mit solchen Fragen frühzeitig zu beschäftigen. In gewisser Weise stellt das ja auch einen Schritt in Richtung Lebensende dar, also nichts, womit wir uns gerne auseinandersetzen. Wird es auffällig, dass bestimmte Dinge im Alltag der Eltern nicht mehr so gut funktionieren, sprechen wir letztlich ja von Verlusten. Auch ich habe mit meiner Mutter die Erfahrung gemacht, dass wir damals über bestimmte Fragen nicht gesprochen haben. Ich hatte sicher auch Angst, sie traurig zu machen. Ihr den Eindruck zu vermitteln, sie abschieben zu wollen. Nicht über solche Themen zu sprechen bewahrt jedoch nicht davor, eines Tages wichtige Entscheidungen treffen zu müssen. Das ist ein Prozess …
… der ja auch mit einem gewissen Rollentausch zwischen Eltern und Kindern einhergeht.
Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Begriff in Gänze greift. De facto bleiben es ja immer Mama und Papa, und bleibt man auch immer deren Kind. Ohne Frage aber legt man allmählich diese kindliche Rolle ab und übernimmt zunehmend Aufgaben und auch Verantwortung für die Eltern, wenn diese tatsächlich eines Tages auf Hilfe oder eben Pflege angewiesen sind. Nicht selten fällt es dann der einen Seite schwer, loszulassen und Unterstützung anzunehmen. Und auch für die Töchter und Söhne ist es ein Balanceakt: Man möchte das Beste für die Eltern, gleichzeitig aber auch nicht übergriffig wirken – etwa durch das Beauftragen eines Pflegedienstes.
Welche Assoziationen ruft der Aspekt Pflege in unserer Gesellschaft mitunter hervor?
Pflege wird häufig als ein eher schweres Thema wahrgenommen, verbunden mit Krisen und Herausforderungen. Wer einen Menschen zuhause pflegt, erlebt dies unter Umständen als kräftezehrend, emotional und anstrengend. Wir alle möchten alt werden – aber nur ungern darüber sprechen, was es bedeutet, irgendwann auf die Pflege und Unterstützung anderer Menschen angewiesen zu sein. Die Angst davor, in einer leistungsorientierten Gesellschaft Hilfe zu benötigen, spielt da sicher eine große Rolle. Wir pochen auf unsere Freiheit und Selbstständigkeit, doch ein gut funktionierendes Miteinander wird umso notwendiger, wenn gewisse körperliche oder auch finanzielle Ressourcen nicht mehr vorhanden sind. Auch in den Medien finden wir oftmals stereotype Darstellungen von Pflege: Da sehen wir die Ehefrau, die sich heroisch aufopfert, um ihren Mann zu pflegen. Oder Menschen, die leiden. Das möchte ich auf keinen Fall relativieren, aber meine Mutter hat nicht 13 Jahre lang gelitten. Wir hatten auch viele unbeschwerte und nahe Momente. Es ist so wichtig, zu wissen, dass diese positiven Seiten ebenfalls existieren. Dass es auch bei einer Diagnose wie Demenz viele Dinge gibt, die man tun kann, um gut zu leben.
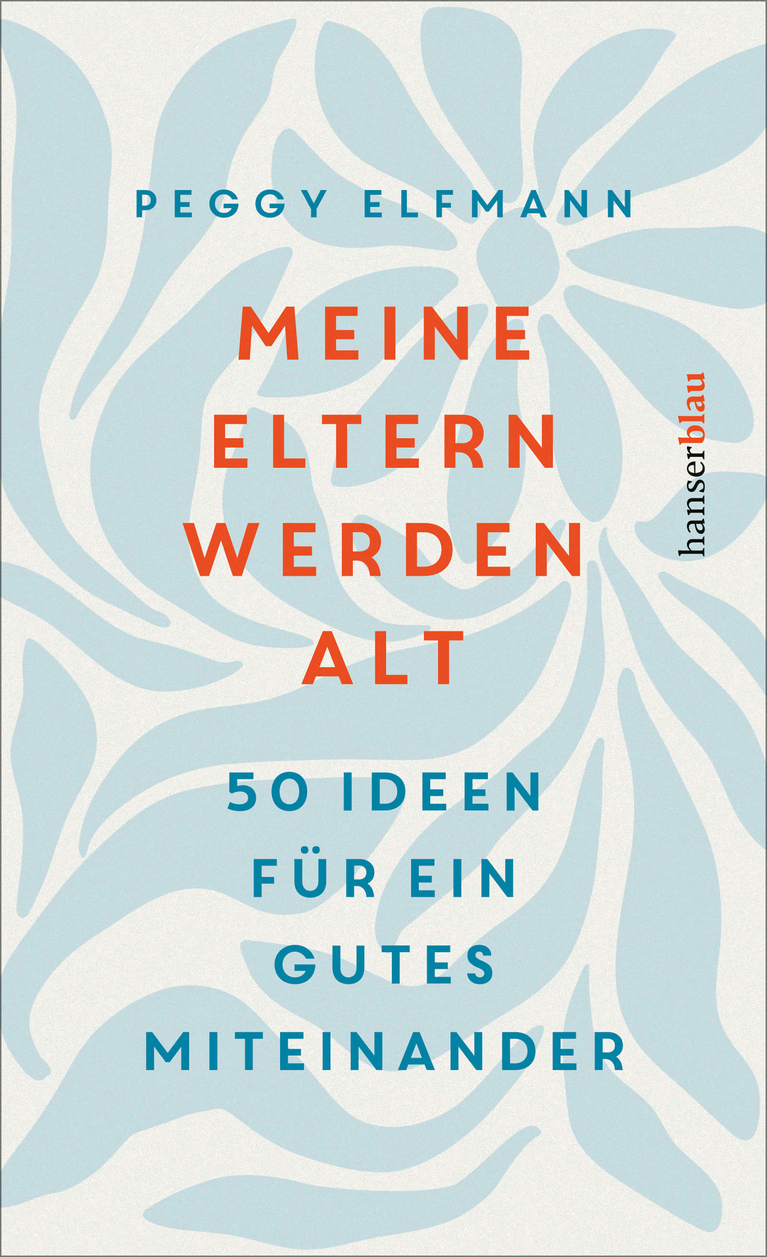
Indem man nicht nur die Fähigkeiten betrachtet, die verlorengegangen sind?
Es ist ja ganz normal, dass man Dinge betrauert, die allmählich verschwinden. Gleichzeitig hilft es aber auch ungemein, bewusst auf das zu schauen, was im Alltag noch funktioniert und sich zu fragen, wie man diese Fertigkeiten unterstützen kann. Ein praktisches Beispiel: Meiner Mama war es irgendwann aufgrund ihrer Erkrankung nicht mehr möglich, alleine zu essen. Auch das Trinken fiel ihr schwer. Da war es wertvoll, ressourcenstärkend vorzugehen und nicht vorschnell sämtliche Schritte für sie zu übernehmen. Wurde die Mahlzeit in kleine Stücke geschnitten oder ihre Hand mit der Tasse zum Mund geführt, war dies von Erfolg gekrönt. Auch im Rahmen einer Pflegebedürftigkeit können Menschen durchaus noch bestimmte Dinge des Alltags selbstständig tun. Was es benötigt, sind jede Menge Ruhe, Zeit und Geduld der Angehörigen, um sich in solchen Situationen buchstäblich daneben zu setzen. In unserer Gesellschaft geht es eher unter, wie groß doch diese Aufgabe ist.
Treten im Alter körperliche Handicaps auf, lauern in den eigenen vier Wänden plötzlich neue Stolperfallen: Was kann hier für mehr Sicherheit und eine bessere Orientierung sorgen?
Sind die Eltern dafür offen, bietet es sich an, gemeinsam solche Stolperfallen ausfindig zu machen. Dabei soll es nicht darum gehen, per se überall Gefahren zu vermuten. Vielmehr gilt es, genau hinzuschauen und Herausforderungen zu erkennen. Bei einer Demenz ist es beispielsweise ganz typisch, dass Betroffene nachts wach werden, die Toilette aufsuchen möchten, aber das Bad nicht finden. Was für Unterstützungsmöglichkeiten gibt es also für diese Menschen mit Orientierungsschwierigkeiten? Es is gar nicht so einfach, herauszufinden, wie sich solch ein Alltag gestaltet, wenn man nicht selbst ein paar Tage vor Ort verbringt oder nicht weiß, welche konkreten Fragen zu stellen sind. Mit Blick auf bauliche Anpassungen, die der Barrierefreiheit dienen, sorgen sich nicht wenige auch um die teils hohen Kosten. Da sollte man sich über finanzielle Unterstützungen seitens der Pflegeversicherung – die sogenannten wohnumfeldverbessernden Maßnahmen – informieren. Wie bei so vielen Vorschlägen und Schritten geht es natürlich auch hier nicht darum, übergriffig das Zuhause der Eltern zu verändern.
Mit ähnlich viel Fingerspitzengefühl sollten Angehörige wohl auch bei diesem Thema vorgehen: Die Fahrtüchtigkeit im Alter …
Ein häufig – nicht selten emotional – diskutiertes Thema, das auch schon zwischen meinem Vater und mir zur Sprache kam. Ich glaube, da fällt es manchen Eltern schwer, den Beobachtungen der Kinder zuzustimmen oder Ratschläge anzunehmen. Hier kann es hilfreich sein, jemanden von außen mit ins Boot zu holen, um die Verkehrssicherheit professionell bewerten zu lassen. Externe Personen also, wie etwa der Hausarzt oder ein Neurologe. Gerade im Alter und bei kognitiven Einschränkungen verändert sich ja die eigene Wahrnehmung. Auch konkrete Tests der Fahrtüchtigkeit sind denkbar, etwa im Rahmen einer gemeinsamen Fahrstunde, angeboten vom ADAC oder einer Fahrschule. Für die Kinder stellt es eine Entlastung dar, wenn sie sich hier auf die Expertise anderer berufen können.
Was raten Sie Familien, wenn Themen wie „Betreutes Wohnen“ oder „Pflegeheim“ aufkommen? Wie können da aus abstrakten Überlegungen greifbare Eindrücke werden?
Viele Einrichtungen bieten einen „Tag der offenen Tür“ an oder verfügen über Cafés, die zum Besuch einladen. Gute Möglichkeiten, um sich vor Ort einen ersten Eindruck zu verschaffen und gemeinsam den oben genannten Themen zu nähern. Nicht wenige Menschen verbinden mit Pflegeheimen eher negative Assoziationen, kennen aber beispielsweise auch nicht die Unterschiede zwischen Betreutem Wohnen, einem Seniorenheim und Pflege-WGs. Als klar wurde, dass die Betreuung meiner Mutter zuhause nicht mehr funktionieren würde, haben wir die Entscheidung getroffen, dass sie in ein Heim zieht. Das ist uns nicht leicht gefallen, „das wollten wir doch vermeiden“, dachte ich damals. Als sie dann aber eingezogen war, wurde mir schnell bewusst, wie gut meine Mutter dort aufgehoben war. Natürlich war dieser Schritt auch von einer gewissen Schwere gekennzeichnet, stellte er doch vor allem für meinen Vater einen großen Abschied dar. Meine Mutter aber genoss dort in ihren letzten Wochen die beste pflegerische und medizinische Versorgung.
Sie haben Ihre an Alzheimer erkrankte Mutter über mehrere Jahre begleitet und gepflegt – im Buch berichten Sie auch von Selbstvorwürfen und Schuldgefühlen. Inwiefern half und hilft das Schreiben dabei, sich von solchen Emotionen zu lösen?
Ich denke, dass es heilsam sein kann, sich mit den eigenen Emotionen und Gedanken auseinanderzusetzen: Trauer, Wut, Hoffnung – es ist nicht leicht, solch ein Gefühlschaos zu bewältigen. Da tut es gut, Dinge notieren und schon beim Schreiben reflektieren und vielleicht sogar loslassen zu können. Sich rückblickend zu fragen, wie es mir in einer bestimmten Situation ergangen ist. Als Journalistin hilft mir da das Schreiben, für andere ist es vielleicht das Sprechen in einer Angehörigengruppe oder im Rahmen einer Therapie. Das Versorgen einer geliebten Person ist oft eine sehr emotionale Aufgabe. Oft höre ich von anderen Pflegenden, dass sie sich mit Schuldgefühlen und Selbstvorwürfen à la „Man hätte doch so Vieles besser machen können!“ auseinandersetzen mussten. Ich habe mal einen Abschiedsbrief an mein schlechtes Gewissen verfasst. Darin kam ich zu dem Schluss: „Du fühlst dich vielleicht manchmal schlecht – aber du hast immer dein Bestes gegeben!“
Sie resümieren im Buch: „Pflegen ist etwas, das in den Familien stattfindet, aber wir dürfen Pflege nicht länger als Familiensache behandeln.“ Wie kann das gelingen?
Da lohnt ein Blick in die Berufswelt: Das Thema „Elder Care“, also eben die Betreuung und Pflege von Angehörigen, ist dort noch nicht merklich angekommen. Durchaus existieren Unternehmen, die ihren Angestellten, die aufgrund einer entsprechenden Situation weniger oder gar nicht arbeiten können, entgegen kommen und unterschiedliche Angebote schaffen. Ein wichtiger Aspekt für pflegende Angehörige ist fast immer die Flexibilität: Idealerweise wird in Mitarbeitergesprächen also nicht nur die Kinderbetreuung aufgegriffen, sondern eben auch der Spagat Berufstätigkeit vs. Pflege der Eltern. Wer seine persönliche Situation nicht mit Vorgesetzten besprechen möchte oder kann, findet vielleicht Verbündete im eigenen Team, denen er sich anvertrauen kann – gerade dann, wenn zuhause unerwartete Ereignisse eintreten. Die persönliche Situation pflegender Familienmitglieder muss noch deutlich sichtbarer gemacht werden.



