Eine Demenzerkrankung bringt für Betroffene und ihre Angehörigen allerlei Veränderungen und Herausforderungen mit sich. Umso wichtiger ist es, sich von der Diagnose nicht entmutigen zu lassen: Denn trotz neuer Aufgaben, Rollen und Unsicherheiten sind weiterhin positive Erlebnisse möglich. Unsere Buchtipps basieren auf Erfahrungsberichten, führen hilfreiche Alltagstipps auf und beleuchten die Phase, in der sich das Eltern-Kind-Verhältnis allmählich umkehrt.
Alte Eltern
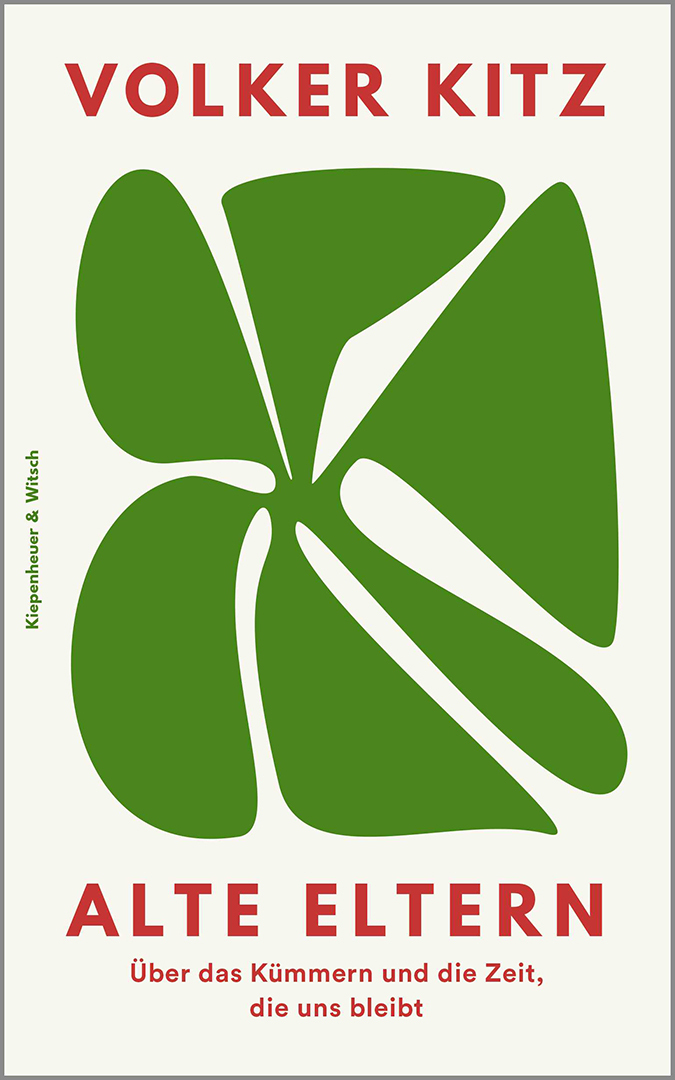
„Ich werde bald einen Kuchen backen, mit der Blechherzform, die unsere Mutter für jeden unserer Geburtstage benutzte. Mein Vater wird nicht verstehen, was die 8 und die 0 auf dem Kuchen mit ihm zu tun haben.“ In seiner aktuellen Veröffentlichung „Alte Eltern. Über das Kümmern und die Zeit, die uns bleibt“ erzählt der Publizist und Autor Volker Kitz die Geschichte seines an Demenz erkrankten Vaters, der erst unmerklich, und dann immer deutlicher die Orientierung in seiner Welt verliert. Von den ersten kleineren Alltagsproblemen bis hin zu dem Tag, an dem der Vater vergisst, wie man schluckt, beleuchtet Kitz eine Zeit der Unsicherheiten, der Übernahme von Verantwortung, und letztlich auch des Abschieds. Damit berührt der Autor in diesem literarischen Essay Fragen, die eine ganze Generation betreffen. Denn auch Volker Kitz erkennt in seinem Werk rückblickend: „Selbst als wir wussten, worum es ging, als die Leugnungsphase an Verteidigungskraft verlor, dachte ich nicht, dass ich meinen Vater bald in so extremen Situationen erleben würde.“
Dann zitter ich halt
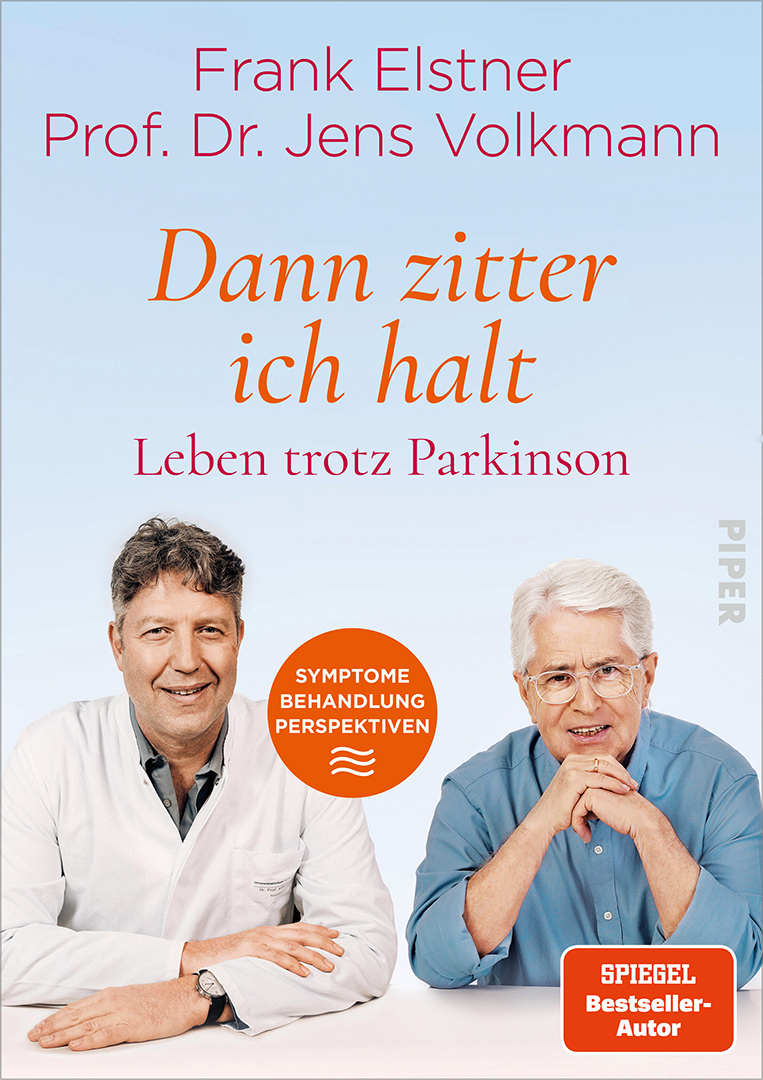
Frank Elstner, Showmaster und Erfinder von Formaten wie „Wetten, dass..?“, hat im Jahr 2019 seine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht. Seitdem unterstützt er die Parkinson Stiftung und hat gemeinsam mit dem Neurologen und Siftungsvorsitzenden Jens Volkmann das Buch „Dann zitter ich halt“ veröffentlicht. Darin beantwortet das Duo Fragen wie „Was sind die ersten Anzeichen von Parkinson?“ oder „Welche Therapien und Medikamente gibt es?“. Das im Buchtitel erwähnte Zittern hat Elstner zu Beginn der Erkrankung laut Eigenaussage als Nebenerscheinung seines Lampenfiebers eingeordnet; erst als ein Neurologe Parkinson diagnostizierte, befasste sich der Journalist und Moderator ausführlich mit den Symptomen und Behandlungsmöglichkeiten. „Ich las diverse Studien und jede Menge einschlägige medizinische Abhandlungen, sah mir Filme an und versuchte, aus den Berichten von Betroffenen Parallelen zu dem zu finden, was ich gerade fühlte“, so Elstner. Neben Einblicken in den neusten Stand der Forschung verpassen es die Autoren nicht, in „Dann zitter ich halt“ auch den Menschen mit Parkinson im Blick zu behalten.
Nicht mehr wie immer
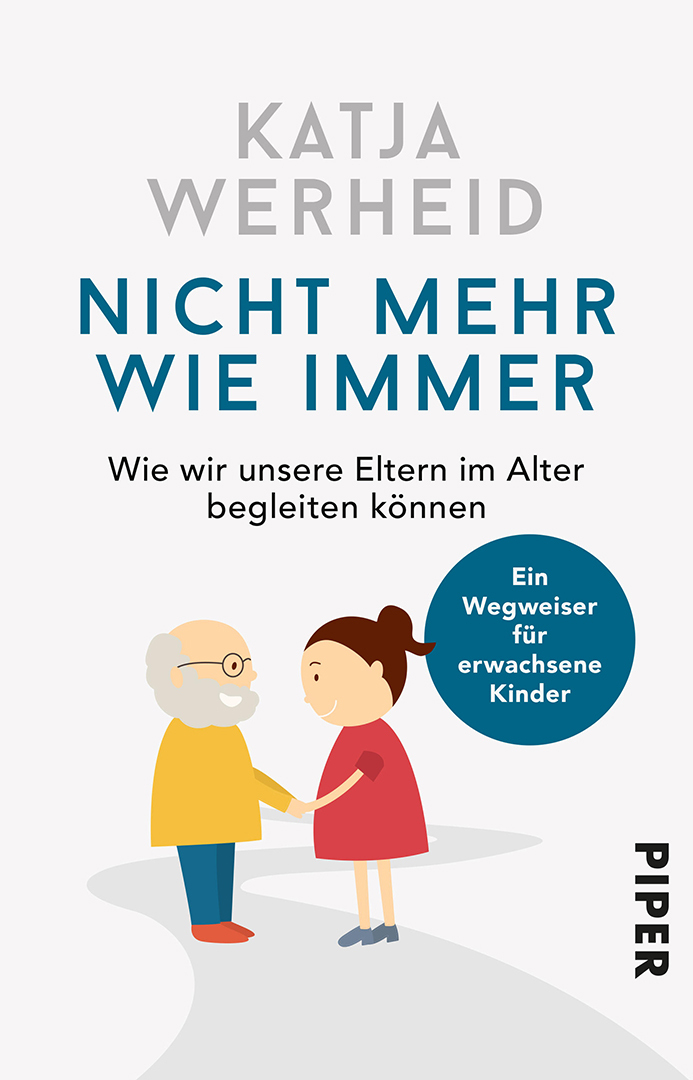
„Unter uns »Mittelalten« geht ein Gespenst um. Es schleicht sich ein, man merkt es anfangs kaum, versteckt hinter dem lauten Getöse von Midlife-Crisis, Pubertät der Sprösslinge, Bandscheibenvorfall und Menopause. (...) Sein Name? Die banale wie unumstößliche Einsicht: Unsere Eltern werden alt.“ Mit dieser Erkenntnis beginnt Katja Werheid, Professorin für Klinische Neuropsychologie und Psychotherapie an der Universität Bielefeld, ihr Buch „Nicht mehr wie immer“. Auf knapp 200 Seiten beleuchtet die Autorin die Fragen, was zu tun ist, wenn sich das Eltern-Kind-Verhältnis umkehrt und wie es gelingen kann, für die alternden Eltern da zu sein, ohne sie zu bevormunden. Auch warnt Werheid vor gewissen „Blitzangriffen“ und empfiehlt vielmehr Empathie und Offenheit in der Kommunikation mit den Eltern. Denn wer frühzeitig miteinander ins Gespräch kommt, schafft beste Voraussetzung dafür, die Elternbeziehung zu vertiefen.
Demenz verstehen und mutig begegnen
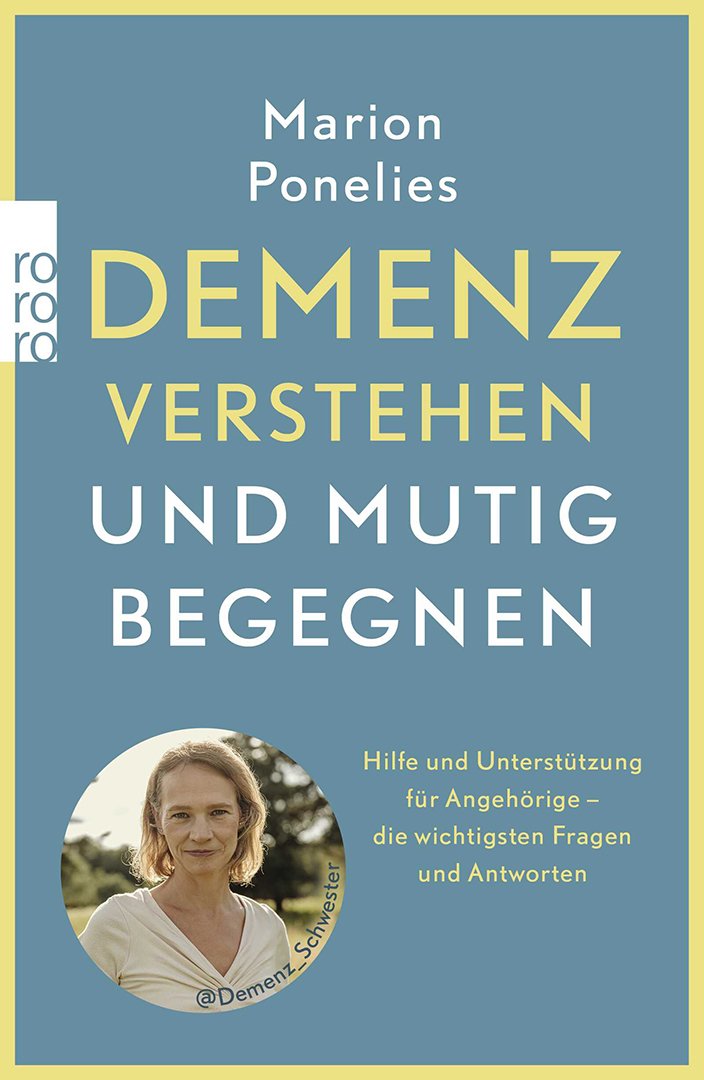
Marion Ponelies möchte ihre Leserschaft – wie es der Buchtitel verrät – ermutigen, „den inneren Demenz-Helden zu erwecken.“ Denn Mut, so ist sich die examinierte Krankenschwester sicher, ist der beste Weg, um dieser Erkrankung zu begegnen. In ihrem Ratgeber bietet Ponelies Hilfe und Unterstützung für Angehörige und beantwortet dabei die wichtigsten Fragen: Was passiert bei Demenz im Gehirn? Wie überzeuge ich meinen Angehörigen vom Pflegeheim? Und wie reagiere ich, wenn er mich nicht mehr erkennt? Dabei führt die Autorin Schritt für Schritt durch alle Demenzstadien und hält praxiserprobte Tipps bereit, damit der herausfordernde Umgang mit der Erkrankung dennoch mit Herz und Stärke gelingt. Den Funktionen unseres Gehirns stellt Marion Ponelies zudem kurz und knapp die Folgen der Demenz gegenüber, mit denen Betroffene zu kämpfen haben: Sprechen – vergisst oder verwechselt Worte / logisches Denken – trifft ungünstige Entscheidungen / Moral und soziale Regeln – ist emotional aufbrausend oder emotionslos … Ein Ratgeber, der zum achtsamen Umgang mit Demenz einlädt.
Der Bademeister ohne Himmel
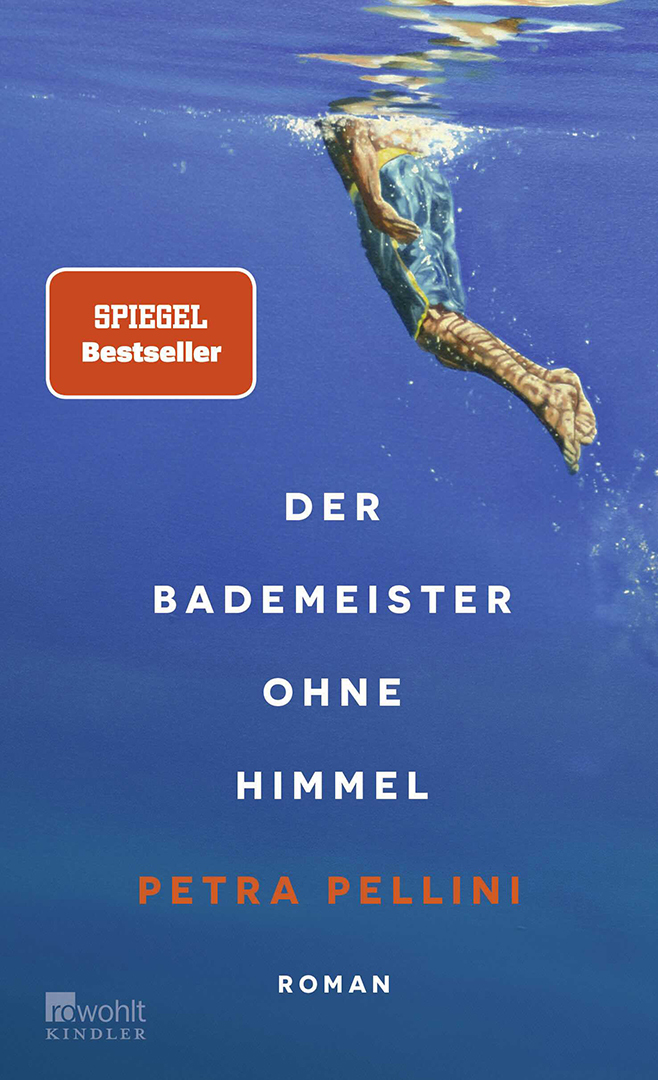
Die Journalistin und Moderatorin Christine Westermann sieht in Petra Pellinis Romandebüt „Der Bademeister ohne Himmel“ eines dieser Bücher, „die lange nachhallen.“ Erzählt wird die Geschichte der fünfzehnjährigen Linda, die mit ihrem Leben hadert und lediglich in zwei Menschen noch Halt findet: In Ihrem einzigen Freund Kevin sowie Hubert, einem Bademeister im Ruhestand, der sich weitestgehend aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hat. Mal toastet der an Demenz erkrankte 86-Jährige Karotten, dann wiederum wartet er sehnsüchtig auf seine Frau, die bereits vor sieben Jahren verstorben ist. Gemeinsam mit der polnischen Pflegerin Ewa versucht Linda in dieser schwarzhumorigen Erzählung den „Bademeister ohne Himmel“ im Leben zu halten, doch das Schicksal scheint andere Pläne zu haben … Die Autorin Petra Pellini war lange in der Pflege demenzkranker Menschen tätig und lässt in ihren Erstling viele Erfahrungen aus dieser Arbeit einfließen.
Lückenleben
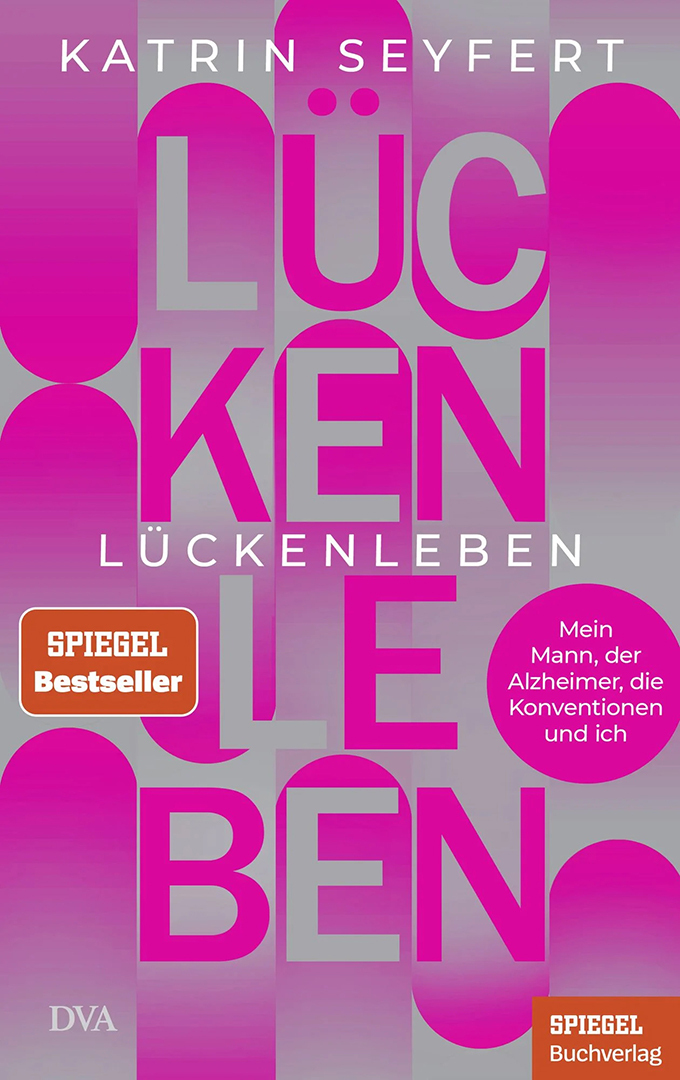
Die freie Journalistin Katrin Seyfert (*1971) ist unter anderem für ZEIT, Süddeutsche Zeitung und SPIEGEL tätig; im letztgenannten Magazin berichtet sie seit 2019 regelmäßig über die Alzheimer-Erkrankung ihres Mannes. Dieser, Arzt und Vater von fünf Kindern, war Anfang 50, als er die entsprechende Diagnose erhielt. Fortan übernahm Katrin Seyfert die Organisation der Pflege, der Finanzen, des gesamten Familienalltags – und letztlich auch der Beerdigung. In „Lückenleben“ zeichnet sie schonungslos nach, wie ihr Partner schrittweise die Sprache und somit auch seine Identität verlor. Seyfert fragt: „Darf man über Krankheit, Sterben, Tod öffentlich reden, oder ist das immer noch ein Tabu?“ Auch hadert sie mit den ihr zugeschriebenen Rollen – erst als pflegende Ehefrau, später dann als Witwe. Bei der Bewältigung einer Krankheit, so hält die Autorin fest, sind immer zwei Ebenen zu betrachten: „Die eine, medizinische, lebt von guten Ärzten, guten Medikamenten, einer Therapie, vielleicht einer Pflegeunterstützung. Die zweite Ebene lebt von den Angehörigen, ihrer Kraft und ihrer Originalität, weiterzumachen, obwohl alles anders geworden ist.“



