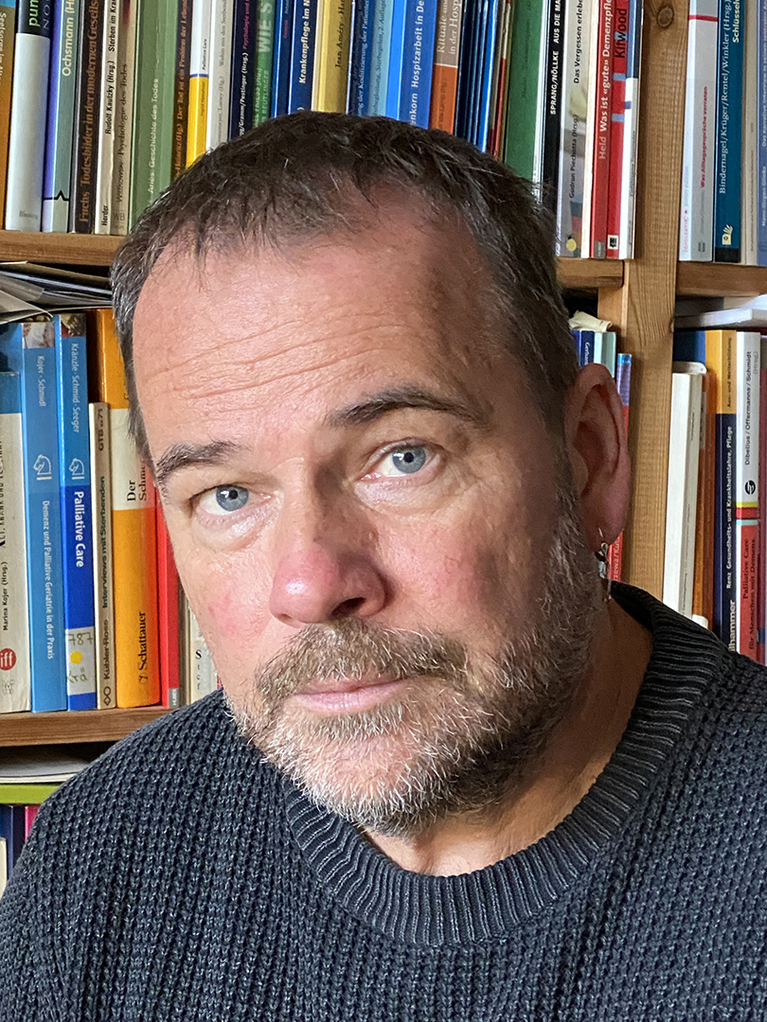
Gerät die Versorgung eines Menschen mit Demenz für Angehörige mehr und mehr zur Herausforderung oder reicht eine Kurzzeitpflege nicht mehr aus, besteht die Möglichkeit, vollstationäre Pflege zu organisieren. Doch wie steht es in den Einrichtungen um Selbstbestimmung, individuelle Betreuung oder Angebote, die das Wohlbefinden fördern? In einem Wohnbereich des Julie-Kolb-Seniorenzentrums in Marl (NRW) basiert der Alltag auf einer „Hausunordnung“: Deutschlands erste sogenannte Gammel-Oase beheimatet 14 Bewohnerinnen und Bewohner mit mittelschwerer bis schwerer Demenz, für die starre Regeln wie feste Wasch-, Essens- oder Zubettgehzeiten nicht gelten. Vielmehr geben die Pflegenden die „Regie“ ab, begegnen den Seniorinnen und Senioren dabei aber jederzeit auf Augenhöhe. Nachgefragt bei Dr. Stephan Kostrzewa, der das Konzept des Therapeutischen Gammelns entwickelt hat.
Wie wichtig ist es bei einer Demenzerkrankung, kognitive Fähigkeiten anzuregen, um unter anderem das Selbstwertgefühl der betroffenen Person zu stärken?
Dr. Stephan Kostrzewa: Das Anregen kognitiver Fähigkeiten und die Stärkung des Selbstwerts sind zwei Bereiche, die sich durchaus gegenseitig ausschließen können. Fertige Vorstellungen davon, was ein Mensch mit Demenz benötigt, sind nicht zielführend. Daher bin ich auch kein Verfechter der sogenannten aktivierenden Pflege, es sei denn, die Patientin oder der Patient wünscht sich diese explizit, etwa in Form eines Gedächtnistrainings. In der Praxis erlebe ich das jedoch leider meist anders: Da werden von Angehörigen oder Pflegenden solche Aktivierungen ohne das Einverständnis der Erkrankten angewendet. In Marl hingegen schauen wir in erster Linie darauf, ob es dem Menschen gut geht. Ob er Wohlbefinden zeigt. Das ist der einzige Maßstab jeglicher Intervention und jeglichen Handelns. Gerade bei einer mittleren oder fortgeschrittenen Demenz mache ich nicht die Erfahrung, dass Betroffene noch in irgendeiner Form „trainiert“ werden möchten. Es ist aber möglich, Utensilien mit Aufforderungscharakter passiv anzubieten, indem man beispielsweise Zeitschriften oder Bastelartikel auf den Tischen der Pflegeeinrichtung platziert. Ausschließlich die demenziell erkrankte Person schätzt dabei ein, was für sie attraktiv ist.
Während Ihrer Ausbildung zum examinierten Altenpfleger galt noch die Auffassung, dass Menschen mit Demenz eine klare und enge Tagesstruktur benötigen …
Solcherlei Ansätze sind heute, rund 35 Jahre später, nicht mehr zeitgemäß. Auch besteht diesbezüglich keine wissenschaftliche Expertise. Es konnte also nicht bestätigt werden, dass sich etwas an einer Demenz verbessert, wenn von außen eine exakte Tagesstruktur vorgegeben wird. Da ich beruflich auch in der Hilfe für Menschen mit Behinderungen tätig bin, kann ich aus diesem Bereich einen tollen Leitsatz nennen: „Hol den Menschen dort ab, wo er stark ist.“ Denn das Hervorheben von Fähigkeiten und Kompetenzen erzeugt Zufriedenheit und stärkt die jeweilige Autonomie. Das, was ein Mensch nicht mehr kann – Dinge, die ihm vielleicht sogar unangenehm sind – vermeide ich. Eher gilt es doch, mit jeder Interaktion ein Mehr an Lebensqualität zu erzielen. Diese Prämisse greift natürlich nicht immer. Dank des Therapeutischen Gammelns machen wir allerdings stets die Erfahrung, dass sich für die Bewohnerinnen und Bewohner mit Demenz zumindest zeitweilig Situationen des Wohlbefindens erzeugen lassen.
Die Idee des Therapeutischen Gammelns kam Ihnen bereits im Jahr 2017; später wurde dann ein dazugehöriges Konzept ausformuliert.
Ursprünglich besitze ich einen Hintergrund in der Palliativmedizin, verbunden mit mehrjähriger Arbeit im Hospiz: Dort käme niemand auf die Idee, dass der Sterbende noch aktiviert werden oder ein Gedächtnistraining erhalten muss. Mit Blick auf die Selbstbestimmung eines Menschen kam daher recht schnell die Idee auf, diesen Gedanken auf demenzielle Erkrankungen zu übertragen – insbesondere im mittleren und fortgeschrittenen Stadium. Übrigens: Zahlen belegen, dass bis zu 85 Prozent der Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner an chronischen Schmerzen leiden, aber lediglich 40 bis 50 Prozent dieser Personen eine dauerhafte Schmerztherapie erhalten. Da zeigt sich deutlich: Je dementer ein Mensch ist, desto weniger Schmerzmittel werden ihm verabreicht. Schmerzverursachende Krankheitsbilder wie Rheuma, Arthrose, Osteoporose oder Gicht verschwinden aber nicht, wenn noch eine Alzheimer-Demenz dazukommt.

Wie äußert sich dieser Umstand im Alltag der Gammel-Oase?
Da bei der fortgeschrittenen Demenz meist die Sprache zerfällt, bleibt den Betroffenen nur die Möglichkeit, sich nonverbal über bestimmte Körpersignale mitzuteilen – diese müssen wir aber auch lesen können. Im Rahmen des Therapeutischen Gammelns treten wir deshalb einen Schritt zurück und schauen, welche Diagnosen neben der Demenz bestehen. Man kann Schmerz nicht messen, aber Schmerzverhalten gut beobachten. Das gilt es zu schulen, auch mit den beteiligten Ärztinnen und Ärzten sowie Angehörigen. Da erleben wir in der Marler Gammel-Oase durchaus, dass sich viele sogenannte herausfordernde Verhaltensweisen zum Positiven verändern lassen. Eine weitere wichtige Säule des Ansatzes ist es, alles, was an vorgegebener Struktur existiert, radikal infragezustellen: Weshalb muss es feste Weck-, Essens- oder Waschzeiten geben? Wir sind in klassischen Pflegeeinrichtungen ständig damit beschäftigt, unsere Normalität den Demenzerkrankten überzustülpen. In der Gammel-Oase machen wir das nicht. Natürlich gibt es da vielleicht die ältere Dame, die früher immerzu adrett und schick gekleidet das Haus verlassen hat – in der Demenz merken wir aber plötzlich, dass ihr dies gar nicht mehr wichtig ist. Wir möchten nicht nur darauf schauen, was der Mensch früher war, sondern vor allem auch darauf, was er jetzt ist. Daher ist das Beobachten der Pflegebedürftigen die dritte wichtige Säule.
Wie kann es gelingen, Entscheidungsfreiheit zu schenken, wenn bei einer Demenz die Denk- und Handlungsfähigkeiten eingeschränkt sind?
Seit der Gründung im Jahr 2023 orientieren wir uns in der Gammel-Oase des Julie-Kolb-Seniorenzentrums an den erwähnten herausfordernden Verhaltensweisen wie zum Beispiel Unruhe, ständiges Umherlaufen oder die Abwehr von Pflege- und Betreuungsleistungen. Wenn all diese Dinge nachlassen, ist das ein Erfolg. Ein weiterer Indikator ist viel rudimentärer und stammt ebenfalls aus der Palliative Care: Wir richten uns nach dem Muskeltonus. Dieser ist erhöht, wenn ein Mensch Anspannung oder Ärger verspürt. Das Gegenteil ist der Fall, wenn die Bewohnerin oder der Bewohner sich gut und sicher fühlt. Ebenso lohnen sich Blicke auf die Atmung oder die jeweilige Mimik.
Welche Herausforderungen des Zusammenlebens treten in Marl mitunter auf?
In der Pflegeeinrichtung leben insgesamt 14 Bewohnerinnen und Bewohner, die verständlicherweise unterschiedliche Hintergründe und Charakterzüge mit einbringen. Vor Ort existieren ganz bewusst ausschließlich Zweibettzimmer, wissen wir heute doch, dass die Stresswerte einer demenzerkrankten Person im Einzelzimmer höher sind als bei der Doppelvariante. Die jeweiligen Konstellationen des Zusammenlebens schauen wir uns dabei genau an; es kann durchaus mal vorkommen, dass ein Umzug innerhalb des Wohnbereichs vollzogen werden muss. „Einen alten Baum verpflanzt man nicht“ – auch so ein Leitsatz in der Altenpflege, der völlig unwidersprochen hingenommen wird. Natürlich kann man in diesem Falle einen „Baum verpflanzen“, denn wenn das Neue, was der Mensch an Milieu, Umgang oder Mitbewohnern erfährt, besser zu seiner Demenz passt, als das Ursprüngliche, gewöhnt er sich nach einer gewissen Zeit an diese veränderten Strukturen. Auch hier lässt sich dann der Erfolg an Verhaltensweisen wie Entspannung oder einer gesteigerten Selbstbeschäftigung ablesen.
Kein Tag gleicht also dem anderen …
So ist es, die Bewohnerinnen und Bewohner der Gammel-Oase dürfen jeden Tag ausschlafen, vielleicht tragen sie auch mal die Kleidung des Zimmernachbarn oder nehmen ihr Frühstück am Nachmittag ein. Es existiert eine „Hausunordnung": Diese hängt nicht nur einfach an der Wand der Einrichtung oder wird den Angehörigen als Zettel ausgehändigt – sie wird im Vorfeld gründlich besprochen. Eine Demenzerkrankung äußert sich absolut individuell, sodass wir jedem Menschen in seiner Persönlichkeit eine Chance geben. In Marl arbeiten wir eng mit Hausärzten und Neurologen zusammen. Vor allem Letztere hatten zu Beginn Schwierigkeiten mit unseren Vorschlägen, vor allem wenn es um Absetzversuche bei Medikamenten wie Psychopharmaka ging. Wir konnten aber gut argumentieren: Viele Handlungen treten wie erwähnt aufgrund nicht erkannter Schmerzen auf. Deshalb muss die grundlegende Erkrankung behandelt werden, und nicht das jeweilige Verhalten. Auch bei den behandelnden Psychiatern herrschte dahingehend anfangs Skepsis. Heute jedoch sind die beteiligten Medizinerinnen und Mediziner vom Konzept restlos überzeugt. Ich erinnere mich an die Aussage einer Psychiaterin, die mir begeistert mitteilte: „Ich erkenne meine eigenen Patienten nicht mehr wieder!“
Und wie steht es um die Angehörigen?
Eine der ersten Schulungen innerhalb des Teams der Gammel-Oase befasste sich mit der psychischen Situation der Familienmitglieder. Man darf nicht vergessen: Bevor ein Mensch ins Pflegeheim kommt, haben die Angehörigen ihn nicht selten schon mehrere Jahre zuhause versorgt. In der Regel ist das eine sehr isolierte Pflege, rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, ohne Feiertage und ohne Entlastung. Kurzum: Diese Angehörigen sind fix und fertig. Obendrauf kommt möglicherweise noch eine große Portion Frustration, ließen sich doch Versprechen wie „Mutti, ich gebe dich nicht in fremde Hände“ nicht einhalten. Dieser emotionale Mix aus Erschöpfung, Schuldgefühlen und nicht gelebter Trauer kann sich dann in Form von Vorwürfen gegenüber den Pflegenden entladen. Mit dieser Herausforderung gilt es behutsam umzugehen.
Bleiben wir beim Pflegeteam: Wie darf man sich dieses Begegnen auf Augenhöhe mit den Demenzerkrankten vorstellen?
Da gilt: „Jede Korrektur ist eine Kränkung.“ Warum zum Beispiel korrigieren wir ein Kind? Doch aus der Hoffnung heraus, dass es aus dieser Rückmeldung etwas für sein zukünftiges Handeln lernt. Schon allein dieser Zusammenhang ergibt für Menschen mit Demenz keinerlei Sinn. Vor allem aber wissen wir mittlerweile, dass die betroffenen Personen die Begleiterscheinungen ihrer Demenz ganz deutlich wahrnehmen. Sie merken, wie sich der Alltag verändert. Sie verspüren Ängste und Unsicherheiten und nehmen auch Notiz davon, wie ihre Umwelt auf sie reagiert. Dieser Gefühlswelt noch mit Korrekturen zu begegnen, käme einem Pieksen mit dem Finger in die Wunde gleich. Deswegen verzichten wir darauf gänzlich und weisen auch so gut wie möglich nicht auf Defizite hin. Dass sich dadurch das Selbstwertgefühl der Pflegebedürftigen merklich verbessert, versuchen wir auch den Angehörigen zu vermitteln.
Was braucht es, um weitere Pflegeeinrichtungen von der Umsetzung dieses ohne Frage stringenten Ansatzes zu überzeugen?
Seit Jahrzehnten finden in der Demenzversorgung Strukturoptimierungen statt, ohne aber die Erkrankten überhaupt mit einzubinden. Frei nach dem Motto: „Wir wissen schon, was wir tun.“ Die Idee des Therapeutischen Gammelns ist vielen Einrichtungen schlichtweg zu radikal – es fällt ihnen schwer, sich darauf einzulassen. Allerdings hat im Februar 2025 nun Deutschlands zweite Gammel-Oase ihre Pforten geöffnet: Der dortige Einrichtungsleiter konnte mir berichten, dass rund 80 Prozent der Psychopharmaka und Neuroleptika der Bewohnerinnen und Bewohner abgesetzt oder heruntergefahren werden konnten. Das beweist, dass es sich beim Standort in Marl um kein singuläres Ereignis handelt. Und eine weitere Beobachtung ist mir wichtig: Exzellent geschulte Fachkräfte, die schon sehr lange im Pflegebereich tätig sind und frustriert kurz vor dem Absprung standen, haben in der Gammel-Oase eine letzte Möglichkeit gesehen, um noch mal etwas anderes auszuprobieren. Mit dem Ergebnis, dass sie geblieben sind und begeistert feststellen durften: „Deshalb habe ich vor vielen Jahren die Ausbildung absolviert! So wollte ich schon immer pflegen!“



