
Ausweglose Verfolgungsjagden, wiederkehrende Prüfungsängste oder lang zurückliegende Partnerschaften: Viele Träume, an die wir uns am Morgen noch erinnern, werfen Fragen auf oder sorgen für Verwirrung. Bei nicht wenigen Szenarien handelt es sich dabei um dramatisierte Versionen von Themen, die uns auch jenseits des Schlafes beschäftigen, weiß Prof. Dr. Michael Schredl, Traumforscher und wissenschaftlicher Leiter des Schlaflabors am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim. Er verdeutlicht: „Es ist spannend, sich zu fragen, welches Grundmuster der jeweilige Traum hat und welches psychologische Thema er behandelt.“
Während uns manche Träume nach dem Aufwachen noch mehrere Stunden „nachhängen“, erinnern wir uns an andere wiederum oft nur lückenhaft …
Prof. Dr. Michael Schredl: Unter Träumen verstehen wir ein subjektives Erleben während des Schlafes. Dabei unterscheiden wir diese Bewusstseinsebene von den physiologischen Vorgängen, die sich im Gehirn ereignen. Dieses Bewusstsein – davon geht die Forschung aus – ist jederzeit aktiv. Einschätzungen, dass wir ausschließlich im REM-Schlaf träumen, konnten längst widerlegt werden, wir träumen während des ganzen Schlafes. Die einzige Möglichkeit, Zugang zu diesem subjektiven Erleben zu erlangen, ist, sich nach dem Aufwachen daran zu erinnern, was wir zuvor erlebt haben. Aufgrund der Tatsache, dass unser Gehirn als biologisches Organ dabei vom Schlaf- in den Wachmodus umschalten muss, wird die Traumerinnerung jedoch massiv erschwert. Viele Träume gehen bei diesem allmählichen Übergang verloren.
Kann es demnach wertvoll sein, Traumszenarien zu notieren und sich mit ihnen auseinanderzusetzen?
Auch wenn wir nicht wissen, ob Träume eine bestimmte Funktion besitzen, spiegeln sie doch die Themen wider, die uns tagsüber begegnen – und zwar in einer sehr kreativen, manchmal auch emotional-dramatisierten Form. Vor diesem Hintergrund kann es durchaus interessant sein, Träume schriftlich oder per Sprachmemo festzuhalten, denn so erhalten wir einen neuen Blickwinkel auf die Dinge, die uns am Tage beschäftigen. Die Traumerinnerung ist trainierbar, indem man sich während des Aufwachens nochmal aktiv zurückerinnert und bestimmte Szenarien mehrfach wiederholt. Wie beim Auswendiglernen eines Gedichts.
Welche Rolle nimmt dabei die eigene Persönlichkeit ein?
Die Inhalte unserer Träume können persönliche, aktuell relevante Themen des Alltags widerspiegeln – mal banal, mal durchaus schwerwiegend. Dass unser Wachleben dabei nicht eins-zu-eins wiedergegeben wird, sondern sich häufig mit alten Erinnerungen und komplett neuen Dingen mischt, macht die Faszination der Träume aus. Hier kommt auch der psychologische Blick ins Spiel: Wie bin ich früher mit einer bestimmten Situation, die mir nun im Schlaf begegnet ist, umgegangen? Welche Schwierigkeiten habe ich aktuell mit diesem Thema? Und was kann ich aus den Erlebnissen im Traum lernen?
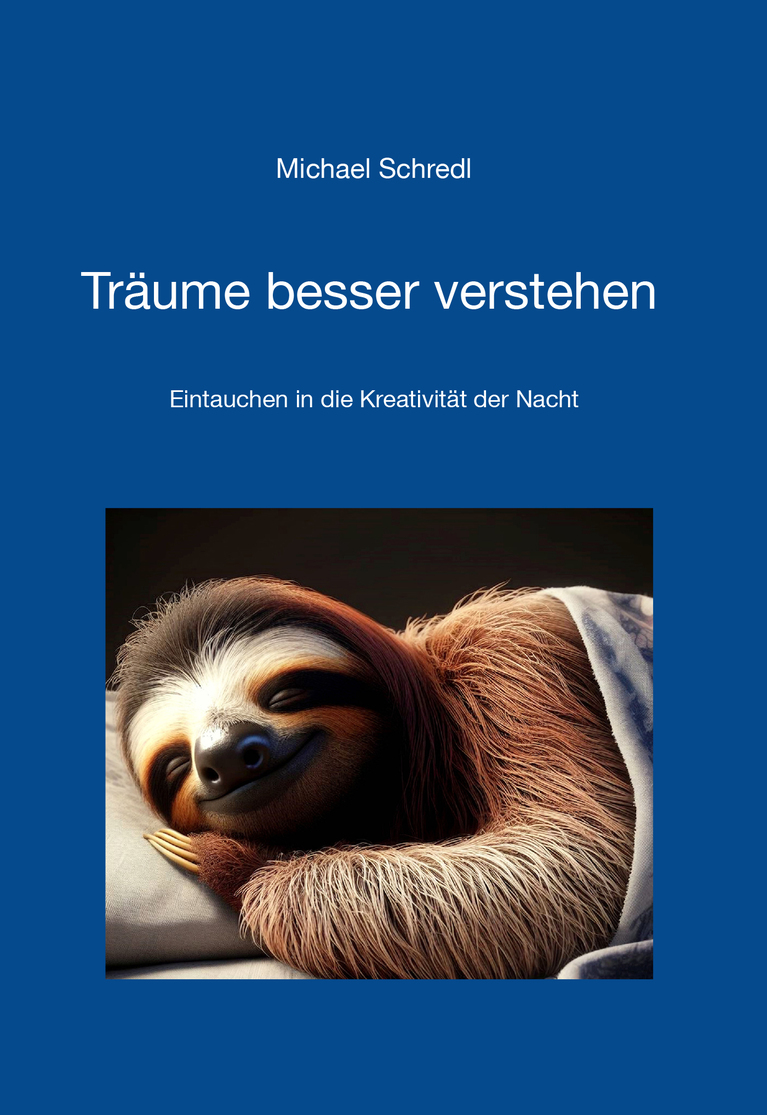
Bereits in der Bibel finden sich Traumdeutungen; Sigmund Freuds Traumtheorie rückte ab 1900 vor allem unbewusste Konflikte und Wünsche in den Fokus. Worin unterscheiden sich heute Traumdeutung und Traumarbeit?
Träume reproduzieren nicht nur, was gewesen ist – sie behandeln auch Sorgen, die sich mit der Zukunft beschäftigen. In der Bibel hatten Träume allerdings die vorwiegende Funktion, direkte Vorhersagen zu tätigen. Auch im antiken Griechenland gab es Versuche, Zukunftsfragen mithilfe von Orakeln zu beantworten. Träumen wurde somit eine Bedeutung zugewiesen, die sich gar nicht erfüllen konnten. Die späteren Symboldeutungen sollten Interessierte dann zu bestimmten Themen führen, die sie im Wachleben beschäftigten. Das Problem: Entsprechende Traumlexika oder heutzutage -webseiten bieten eine Flut an Bildern und Deutungen! Denken wir exemplarisch an einen Hundebesitzer – dieser träumt naturgemäß häufiger von diesem Tier, als jemand, der keinen Hund besitzt. Bei einer Deutung des Symbols „Hund im Traum“ gilt es somit bereits in zwei Gruppen einzuteilen. Hinzu kommen noch Menschen, die in ihrer Kindheit vielleicht schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht haben und auch im Erwachsenenleben noch entsprechend negative Träume erleben. Schon dieses einfache Beispiel zeigt, dass die allgemeingültige Deutung selbst eines einfachen Symboles wie „Hund“ kaum möglich ist.
Bestimmte Motive begegnen uns im Schlaf immer wieder: Was kann hinter solchen Wiederholungsträumen stecken?
Da gibt es ganz typische Themen wie Verfolgungen, Prüfungssituationen oder die Rückkehr in einen früheren Beruf.
Eine unserer Studien hat gezeigt, dass pensionierte Menschen immer noch negative Arbeitsträume haben können, wenn eben auch die Jobsituationen unbefriedigend gewesen ist. Unsere Träume hinken ja immer ein wenig hinterher. Da ist es spannend, sich zu fragen: Welches Grundmuster hat der jeweilige Traum? Welches psychologische Thema wird behandelt? Vielleicht geht es beim erwähnten Beispiel gar nicht konkret um die damalige Arbeitssituation, sondern um Aspekte wie Abgrenzung oder Eigenständigkeit: Der Traum bezieht sich also nicht zwangsläufig auf Erfahrungen mit einst unbequemen Kollegen. Vielmehr werden diese als Beispiel herangezogen, um eine aktuelle Problematik – Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? – darzustellen.
Es gibt bei solchen Träumen also immer auch etwas Neues zu lernen?
Genau, aus diesem Grunde wiederholen sie sich. Ein anschauliches Beispiel aus dem Wachzustand ist hier die Prüfungsangst. Wer nichts dagegen unternimmt, wird diese niemals ablegen können. Kommen aber psychologische Trainings wie Vorstellungsübungen oder Entspannungstechniken zum Einsatz, lässt sich eine Prüfungsangst dank dieser neuen Fähigkeiten überwinden – das heißt, sie kehrt nicht mehr wieder. Das ist bei den Wiederholungsträumen ähnlich: Da gilt es entweder herauszufinden, welche Themen das Erträumte berührt, um diese im Wachzustand zu ändern. Oder man übt anhand des konkreten Traumgeschehens im Wachzustand – Was brauche ich in dieser Situation, damit es mit besser geht? So wird das Traum-Ich stärker und die eigene Einstellung im Wachleben ändert sich auch.
Die erwähnten Prüfungssituationen tauchen in der Traumarbeit regelmäßig auf: Weshalb spielen solche Szenarien selbst Jahrzehnte nach der Schulzeit noch eine Rolle in der Gedankenwelt des Träumenden?
Findet sich jemand im Traum auch Ewigkeiten nach dem Abitur plötzlich wieder in einer unangenehmen Mathematikprüfung wieder, kann dies eine dramatisierte Form der Frage darstellen, was andere über meine Leistungen denken, zum Beispiel im beruflichen Bereich. Das Grundmuster eines Prüfungstraumes ist, dass jemand Ihre Fähigkeiten testet. Auch Sigmund Freud hatte solche Prüfungsträume, allerdings von Prüfungen, die im Wachleben einen positiven Ausgang hatten. Dies deutete er so, dass es bei jenen Szenarien nicht um die erbrachte Leistung an sich geht, sondern vielmehr um die Sorge, wie eine Bewertung durch andere Menschen ausfallen könnte. Denn das Grundmuster „Bewertung der eigenen Leistung durch andere“ ist natürlich ein Thema, das nach der Schulzeit nicht aus unserem Leben verschwindet.
Wie gehen Sie beim Arbeiten mit Träumen praktisch vor? Welche konkreten Schritte kommen dabei zum Einsatz?
Der erste Schritt ist, sich von der Idee zu lösen, dass es konkret um das geht, was sich im jeweiligen Traum ereignet. Da lohnt sich ein Vergleich mit dem Medium Film: Auch dort werden bestimmte Szenarien und Personen ausgewählt, um ein Thema darzustellen. Am einfachsten gelingt das bei klassischen Grundmustern, wie etwa dem bereits genannten Verfolgungstraum. Da liegt ein beherrschendes Thema vor: Die träumende Person läuft vor einer Sache, die ihr Angst bereitet, weg. Sozusagen ein Vermeidungsverhalten in dramatisierter Form. Im nächsten Schritt ist bei der Traumarbeit zu erfragen, ob im aktuellen Wachleben eine Sache existiert, bei der das Thema „Vermeidung“ eine Rolle spielt. Die Erkenntnis wäre dann, dass es sich dabei um keine erfolgreiche Bewältigungsstrategie handeln kann, ist doch auch im Verfolgungstraum die Flucht meist nicht von Erfolg gekrönt. Die Fragen im Wachzustand könnten dann lauten: „Wie lautet die Alternative, wenn mir das Weglaufen nichts bringt? Was benötige ich, um mit einer unangenehmen Situation besser umgehen zu können? Soll ich mir Hilfe holen und mich der Angst stellen?“
Träumen Frauen intensiver als Männer? Oder anders?
Sie erinnern sich durchschnittlich etwas häufiger an ihre Traumerlebnisse. In einer unserer Studien mit dem Titel „Geschlechtsspezifische Traumsozialisierung“ wurden Kinder und Jugendliche dazu befragt, wie häufig sie sich mit der Familie oder innerhalb ihrer Peergroups zu Träumen austauschen. Hinsichtlich der Familie konnten dabei keine größeren Unterschiede zwischen den Geschlechtern ausgemacht werden; bei den Peergroups jedoch war deutlich zu erkennen, dass sich die Mädchen mehr über Träume unterhielten, als die Jungen. Ganz klar: Wer sich mit dieser Thematik ausführlicher auseinandersetzt, erinnert sich letztlich auch häufiger an das Erlebte im Schlaf. Eine maßgebliche Voraussetzung für das Arbeiten mit Träumen.
Beeinflussen gesellschaftliche Krisen, Herausforderungen und Ungewissheiten unser Träumen?
Ein polnischer Kollege hat erst kürzlich die Frage beleuchtet, inwiefern sich der Ukraine-Krieg in den Träumen Geflüchteter festsetzt. Auch der Klimawandel wird diesbezüglich diskutiert; die Corona-Pandemie vor fünf Jahren war natürlich ebenso ein Schwerpunkt. Das Ergebnis: Sämtliche Krisen, die sich weltweit ereignen, spiegeln sich auch in den Träumen der Menschen wider. In einer aktuellen Studie haben wir Personen, die eher zu Alpträumen neigen – das sind die kreativ-sensiblen Charaktere – zu dieser Thematik befragt. Dabei kam unter anderem heraus, dass sie einen übermäßigen Nachrichtenkonsum vermeiden, damit sie nachts besser schlafen können. Träume bilden hier einen Marker für die Frage, wie stark sich erlebte Krisen auf unsere Psyche auswirken. Das beruht letztlich auf den menschlichen Grundbedürfnissen Sicherheit und Geborgenheit.



